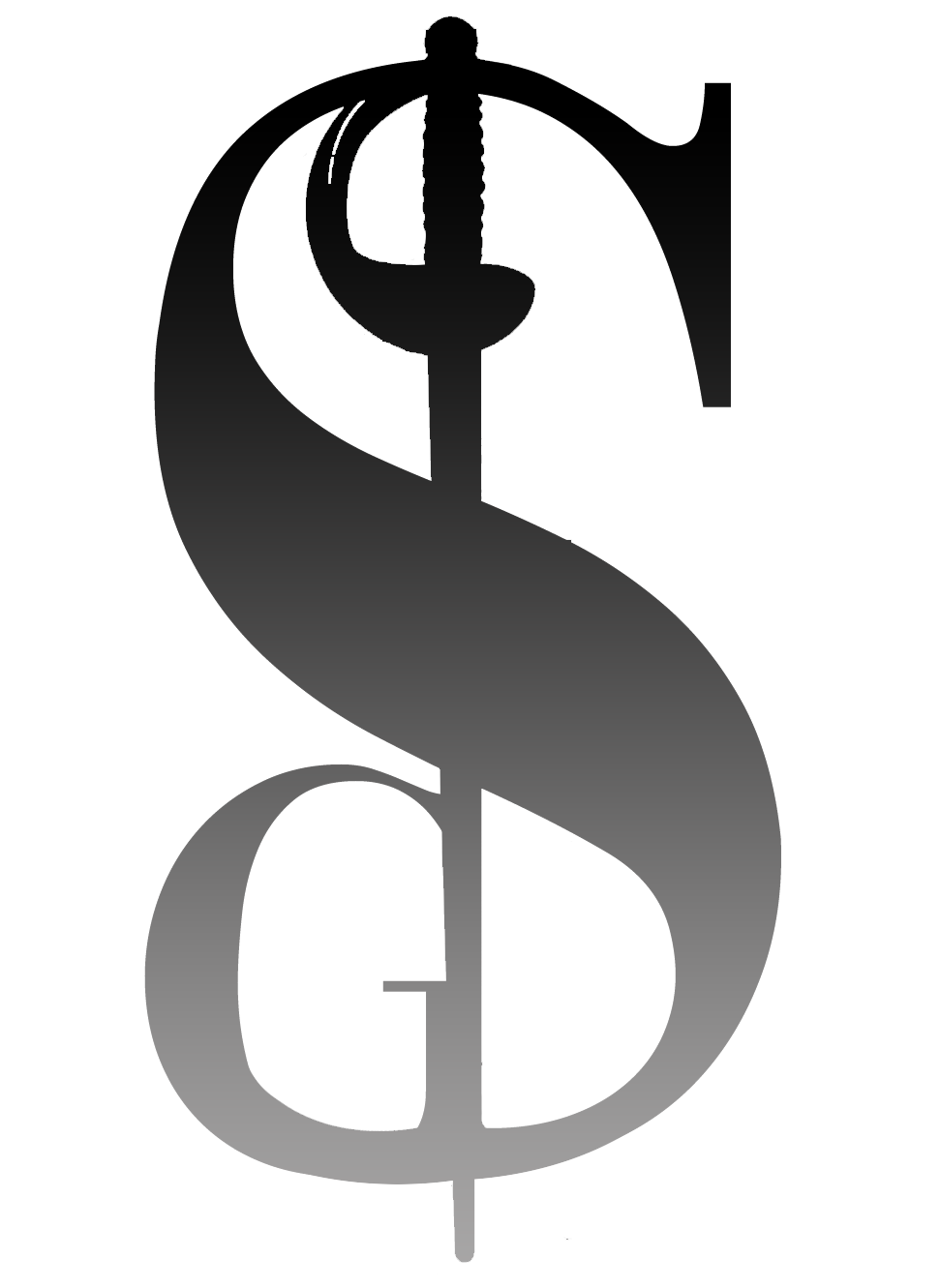An Universitäten und Hochschulen sind schriftliche Prüfungsleisten üblicher Bestandteil der Anforderungen im Studium. Nicht immer gelingt es Studierenden die damit verbundenen methodischen, inhaltlich-formalen und zeitlichen Herausforderungen zu bewältigen, insbesondere nicht, wenn im Studium kaum vorbereitet wurde auf die Anforderungen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit wie einer Bachelorarbeit oder Masterthesis.
In diesem Kontext können Studierende in die Lage kommen, sich externe Hilfe suchen, insbesondere wenn die Betreuung an den Hochschulen real oder vermeintlich kaum gegeben ist. Diese externe Hilfe kann sich auf unterschiedliche Bereiche erstrecken, die auch mit ganz unterschiedlichen Unterstützungsleistungen einhergehen.
In der Praxis führt die Überforderung vieler Studierender zu einem wachsenden Markt für externe Unterstützungsleistungen. Diese reichen vom wissenschaftlichen Coaching bis hin zur vollständigen Texterstellung. Rechtlich stellt sich damit die Frage, inwieweit solche Angebote zulässig sind und welche Grenzen sich aus Zivilrecht, Prüfungsrecht und Strafrecht ergeben.
Was aber ist rechtlich zulässig und ethisch vertretbar?
Betrachtet man sich die diversen und zahlreichen Angebote im Internet, könnte der Eindruck entstehen, dass Ghostwriting eine Dienstleistung ist wie jede andere auch. Dabei reicht die Spannweite von Einzelanbietern bis zu professionellen Agenturen, die mit wissenschaftlichem Anspruch werben. In juristischer Hinsicht ist sie das gewissermaßen auch, zumindest wenn zunächst unberücksichtigt gelassen wird, auf welchen konkreten Zweck sie bezogen wird. Da dieser Artikel sich auf den akademischen (prüfungsrelevanten) Zweck bezieht, kann von einem grundsätzlich unzulässigen Ghostwriting ausgegangen werden.
Zudem können die Grenzen verschwimmen zwischen hilfreicher und legaler Unterstützung wie dem akademischen Schreibcoaching und dem unzulässigen Ghostwriting. Die Unterscheidung ist aus rechtlicher und ethischer Sicht essenziell und soll in diesem Beitrag näher betrachtet werden. Hierfür soll zunächst auf die Merkmale und Unterschiede zwischen beiden Dienstleistungen eingegangen werden.
Für die rechtliche Beurteilung ist zunächst die Art der Leistung zu unterscheiden. Maßgeblich ist, ob der Auftragnehmer eine eigenständige geistige Leistung erbringt oder lediglich beratend tätig wird.
1. Charakteristika und Kernunterschiede
Dienstleistung | Definition | Kernunterschied |
Akademisches Schreibcoaching | Prozessbegleitende Beratung und Anleitung zur Verbesserung der Schreibkompetenz, Methodik, Struktur und Argumentation der Studierenden. Ein guter Schreibcoach agiert als Mentor oder Tutor. | Der Studierende bleibt alleiniger Autor des Textes. Der Schreibcoach bietet lediglich prozessbegleitende Unterstützung, um die Selbstständigkeit und die wissenschaftliche Schreibkompetenz zu fördern, ohne dabei Textpassagen selbst zu formulieren. |
Ghostwriting | Die vollständige oder teilweise Erstellung eines akademischen Textes (z. B. Bachelor- oder Masterarbeit) durch einen Dritten (Ghostwriter), der darauf verzichtet, als Autor genannt zu werden. | Der Ghostwriter erstellt den Text, der Studierende kann ihn als eigene Leistung ausgeben. |
Diese Unterscheidung ist nicht nur praktisch relevant, sondern bildet auch die Grundlage der rechtlichen Subsumtion. Während das Coaching regelmäßig als Dienstvertrag im Sinne von § 611 BGB einzuordnen ist, liegt dem Ghostwriting regelmäßig ein Werkvertrag (§ 631 BGB) zugrunde.
2. Die rechtliche Perspektive
Im Folgenden soll die rechtliche Perspektive von akademischen Ghostwriting und Schreibcoaching eingeordnet werden.
Die rechtliche Beurteilung unterscheidet primär zwischen dem Vertragsverhältnis über die Erstellung des Textes (Zivilrecht) und der Verwendung des Textes als Prüfungsleistung (Hochschulrecht/Strafrecht).
2.1. Ghostwriting: Legalität der Dienstleistung vs. Verbot der Nutzung
A. Der Vertrag (Zivilrecht)
Der Vertrag zwischen dem Ghostwriter und dem Auftraggeber über die Erstellung eines Textes ist in der Regel ein Werkvertrag im Sinne des § 631 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
- Grundsätzliche Zulässigkeit des Vertrages: Der Vertrag über die Erstellung eines Textes als Leistung ist grundsätzlich nicht illegal oder strafbar. Entscheidend ist, dass der Ghostwriter dem Auftraggeber die Nutzungsrechte am Werk überträgt und auf seine Nennung als Urheber verzichtet.
- Keine Sittenwidrigkeit des Vertrages: Die Rechtsprechung hat festgestellt, dass eine Ghostwriter-Abrede nicht generell sittenwidrig im Sinne des § 138 BGB ist. Dies wurde insbesondere durch das Urteil des OLG Frankfurt (Az.: 11 U 51/08) vom 1. September 2009 bestätigt. Hierbei wurde die Dienstleistung an sich als zulässig erachtet, solange die Nutzung des Werkes außerhalb des Hochschulbereichs erfolgt oder es sich um eine reine Mustervorlage handelt. Dies ist auch die legale Basis, auf der sich der Anbieter einer solchen Dienstleistung (der Ghostwriter) bewegt. Zudem sind auch regelmäßig reine Beihilfeleistungen, wie Korrektorat oder Lektorat unproblematisch im Sinne der Sittenwidrigkeit.
B. Die Täuschung (Hochschulrecht und Strafrecht)
Illegal und unzulässig wird Ghostwriting erst in dem Moment, in dem der Studierende die Arbeit als seine eigene Prüfungsleistung bei der Hochschule einreicht. Damit verbunden sind folgende Aspekte:
- Verstoß gegen die Prüfungsordnung: Die Abgabe einer solchen Arbeit verstößt gegen die Prüfungsordnungen der Hochschulen. Dies wird als Täuschungsversuch gewertet und führt in der Regel zur Bewertung der Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0), zum Verlust des Prüfungsanspruchs oder zur Exmatrikulation.
- Strafrechtliche Relevanz (Eidesstattliche Versicherung): Bei Abschlussarbeiten (wie Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten) müssen Studierende i.d.R. eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie die Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst haben. Die Falschaussage in der eidesstattlichen Versicherung kann eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
- Kein Betrug oder Urheberrechtsverletzung: Weit verbreitet ist der Irrtum, dass hier auch Betrug oder Urheberrechtsverletzungen verwirklicht werden. Dies ist jedoch selten der Fall, soweit keine Fördergelder fließen oder fremde Arbeiten als die eigene ausgegeben werden.
2.2. Akademisches Schreibcoaching: Die Legalität der Dienstleistung
Akademisches Coaching ist uneingeschränkt legal. Da der Coach lediglich eine Hilfestellung im Lernprozess leistet (etwa zur Gliederung, Methodik, Zeitmanagement oder Korrektur von Grammatik und Stil), bleibt der Studierende der alleinige Verfasser des Textes. Ein Verstoß gegen Prüfungsordnungen oder eine Täuschungsabsicht liegen nicht vor. Lektorat und Korrektorat fallen ebenfalls in diesen zulässigen Rahmen der akademischen Unterstützung einer Abschlussarbeit. Rechtlich gesehen handelt es sich hier um einen Dienstleistungsvertrag nach § 611 BGB, der keinen konkreten Erfolg schuldet, sondern das Bemühen dort hin.
3. Die ethische Perspektive
Die ethische Dimension ist die eigentliche Trennlinie zwischen den beiden Dienstleistungen. Akademische Integrität gilt als der zentrale Wert.
3.1. Die ethische Fragwürdigkeit des Ghostwritings
- Betrug und Täuschung: Ghostwriting untergräbt die Grundidee der wissenschaftlichen Ausbildung, nämlich die Fähigkeit zur eigenständigen wissenschaftlichen Leistung unter Beweis zu stellen. Die Abgabe einer fremden Arbeit als eigene ist ein Akt der Täuschung.
- Untergrabung der Qualifikation: Der akademische Grad soll belegen, dass der Träger die erforderlichen akademischen Kompetenzen erworben hat. Wird die Abschlussarbeit nicht selbst verfasst, wird diese Qualifikationsaussage in Frage gestellt.
- Wettbewerbsverzerrung: Studierende, die Ghostwriting nutzen, verschaffen sich einen unfairen Vorteil gegenüber jenen, die ihre Arbeit ehrlich und selbstständig erbringen.
3.2. Die Ethik des Schreibcoachings
- Förderung der Selbstständigkeit: Coaching ist ethisch vertretbar und wünschenswert, da es die Lernfähigkeit und Selbstständigkeit der Studierenden fördert. Ziel ist es, die Schreibkompetenz so zu verbessern, dass künftige Arbeiten ohne oder mit geringerer Hilfe verfasst werden können. Wichtig ist dabei, ein guter Coach greift nicht in den Inhalt ein, sondern hilft dabei die eigene Argumentation zu schärfen.
- Transparente Unterstützung: Die Inanspruchnahme eines Coachings ist transparent und verstößt nicht gegen die akademischen Prinzipien, da die geistige Urheberschaft und die Schreibarbeit vollständig beim Studierenden verbleiben.
4. Fazit zur Abgrenzung
Die Abgrenzung zwischen zulässigem Coaching und unzulässigem Ghostwriting liegt also nicht in der Existenz der Leistung selbst, sondern in der Art der Unterstützung und der finalen Verwendung des Textes:
- Coaching (zulässig): Hilfe bei Wie (Methodik, Struktur, Stil), wobei der Studierende selbst schreibt.
- Ghostwriting (unzulässig): Der Ghostwriter schreibt den Text, der Studierende reicht ihn unverändert als eigene Prüfungsleistung ein. Tut er dies aber nicht, und verwendet den erstellten Text tatsächlich lediglich als individuelle „Mustervorlage“ i.e.S., bleibt die Inanspruchnahme des Ghostwriting zulässig bzw. legal. Die Frage stellt sich jedoch, inwieweit es als realistische Auffassung zu betrachten ist, dass jemand ein hohes Honorar lediglich für eine Mustervorlage bezahlt, auch wenn diese individuell für ihn oder sie angefertigt wurde.
Ein weiterer Aspekt, der häufig mit Ghostwriting verwechselt wird, ist das Plagiat. Beide Phänomene überschneiden sich in der Praxis zwar teilweise, beruhen jedoch auf unterschiedlichen Mechanismen. Während Ghostwriting auf einer bewussten Beauftragung und einer vertraglichen Grundlage basiert, liegt beim Plagiat die unautorisierte Übernahme fremder geistiger Leistungen vor – ohne Zustimmung und meist ohne Wissen des ursprünglichen Urhebers.
Juristisch wie ethisch ist diese Unterscheidung von erheblicher Bedeutung. Das Plagiat verletzt Urheberrechte, während Ghostwriting primär eine Täuschung über die tatsächliche Urheberschaft darstellt. In beiden Fällen wird die akademische Integrität beeinträchtigt, doch die rechtlichen Konsequenzen und Beweisprobleme unterscheiden sich erheblich.
Da die Schnittstellen zwischen beiden Bereichen zunehmend an Bedeutung gewinnen, etwa bei KI-gestütztem Schreiben oder Textvorlagen aus Dritthand, soll diesem Thema ein eigener Beitrag gewidmet werden. Dort wird detailliert beleuchtet, wie sich Plagiat und Ghostwriting rechtlich, ethisch und technisch voneinander abgrenzen lassen und wo sich in der Praxis die Grauzonen auftun.
Hinweis: Eine ausführlichere rechtliche und ethische Analyse dieses Themenfeldes findet sich in meinem Buch „Ghostwriter – Die Person hinter den Machern“, das sich intensiv mit den Strukturen, Motiven und Grenzen der Ghostwriting-Branche befasst.
Sebastian Geidel
Rechtsanwalt
Fachanwalt für IT-Recht